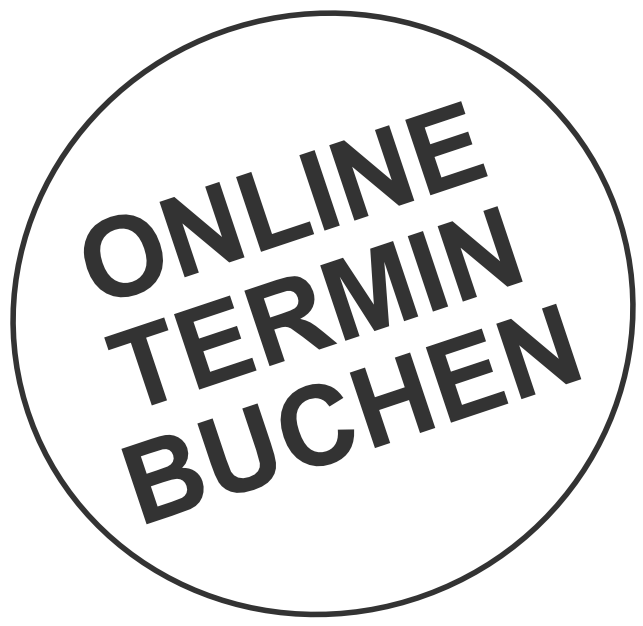Das vordere Kreuzband (VKB) ist einer der wichtigsten Stabilisatoren im Kniegelenk. Es verhindert, dass das Schienbein nach vorne gleitet, und stabilisiert zudem Drehbewegungen. Ohne ein intaktes VKB fühlt sich das Knie häufig instabil an, besonders bei sportlichen Belastungen.
Eine Ruptur des VKB gehört zu den häufigsten Sportverletzungen (ca. 46 pro 100'000 Einwohner pro Jahr). Sie entsteht meist durch plötzliche Richtungswechsel, Sprunglandungen oder Drehbewegungen, oft in Sportarten wie Fussball, Skifahren, Basketball oder Handball.
Begleitverletzungen sind häufig und betreffen unter anderem:
- Meniskus
- Seitenbänder
- Knorpel
- Knochenprellungen (Bone Bruise) oder Frakturen
Nur in etwa 25 % der Fälle reisst das Kreuzband isoliert.
Typisch ist ein plötzliches „Knack- oder Knallgeräusch“ im Knie, gefolgt von einer raschen Schwellung durch Einblutung ins Gelenk.
Weitere Beschwerden:
- Instabilitätsgefühl („Wegknicken“)
- Bewegungseinschränkungen
- Druck- oder Spannungsgefühl durch Schwellung
Nach Abklingen der akuten Schmerzen kann das Knie bei isolierter Verletzung sogar wieder relativ schmerzarm werden – die Instabilität bleibt jedoch.
Röntgen: Ausschluss von Knochenbrüchen.
MRI (Magnetresonanztomografie): Standard zur Beurteilung des VKB und möglicher Begleitverletzungen.
Klinische Untersuchung: Tests wie Lachman-Test oder Pivot-Shift-Test zeigen die Instabilität.
Nicht jede VKB-Ruptur muss operiert werden.
Konservativ: geeignet für ältere Patienten oder Personen mit geringer sportlicher Belastung. Ziel ist die Stabilisierung des Knies durch Muskelaufbau und Koordinationstraining.
Operativ: empfohlen bei jungen, sportlich aktiven Patienten oder bei zusätzlichen Verletzungen (z. B. Meniskusriss).
Die Entscheidung wird individuell getroffen und in einem ausführlichen Gespräch geklärt.
Da das Kreuzband nicht genäht, sondern ersetzt werden muss, verwendet man körpereigene Sehnen (Autograft) oder Spendersehnen (Allograft).
- Hamstringsehnen (Semitendinosus, Gracilis)
- Quadrizepssehne
- Patellarsehne
Alle Methoden zeigen vergleichbare Stabilität.
Vorteile Autograft: körpereigenes Material, etwas geringere Re-Ruptur-Rate.
Vorteile Allograft: keine Entnahmestelle, weniger Schmerzen, aber etwas höhere Re-Ruptur-Rate in älteren Studien.
Bei der Operation selbst wird das Kreuzband nicht genäht, sondern durch eine körpereigene Sehne ersetzt, meist aus dem Oberschenkel oder der Kniescheibe. Alternativ kann auch Spendergewebe verwendet werden. Die Ersatzsehne wird so vorbereitet, dass sie die Funktion des Kreuzbandes übernehmen kann, und anschliessend über kleine Bohrkanäle im Knochen stabil fixiert. Moderne Schrauben oder Plättchen sorgen für den sicheren Halt, viele davon lösen sich im Verlauf von ein bis zwei Jahren selbst auf. In seltenen Fällen wird ein Metallplättchen oder die Schraube am Schienbein später in einem kurzen Eingriff entfernt, wenn es bei knienden Tätigkeiten Beschwerden verursacht.
- Nachblutung, Infektionen (ca. 1%), Thrombose (ca. 1%)
- Sensibilitätsstörungen im Bereich der Entnahmestelle
- Wiederverletzung (Re-Ruptur, ca. 5–10 % Risiko)
- Steifigkeit des Knies (selten)
- Physiotherapie vor der OP („Prehabilitation“): Beweglichkeit und Muskelkraft erhalten für eine bessere Heilung.
- Schwellung und Entzündung sollten möglichst abgeklungen sein.
- Thromboseprophylaxe wird geplant.
- Besprechung des Transplantattyps und OP-Ablaufs in der Praxis.
Bewegung: sofortige Beugung und Streckung erlaubt.
Belastung: Stockentlastung (halbes Körpergewicht) für ca. 4 Wochen.
Thromboseprophylaxe: während Spitalaufenthalt Spritzen, danach oft Tabletten.
Kontrollen:
- 2 Tage postoperativ (Röntgen)
- nach 2 Wochen (Nahtentfernung)
- nach 6 Wochen (Röntgen)
- nach 3 Monaten (klinische Kontrolle)
- nach 1 Jahr (Röntgen + Kontrolle)
- 3 Monate intensive Einzeltherapie
- danach Trainingstherapie (MTT)
- gezielte Übungen für Stabilität, Koordination, Kraft
Alltag & Job: Büroarbeit nach 2–3 Wochen, körperlich belastende Tätigkeiten später.
Freizeit: Fahrradfahren meist nach 6–8 Wochen möglich.
Joggen: nach 3–4 Monaten.
Stop-and-Go-Sportarten (z. B. Fussball, Handball, Tennis): erst nach 9–12 Monaten.
- Ein stabiles Knie nach erfolgreicher Rekonstruktion ermöglicht Rückkehr in Sport und Beruf.
- Ohne Kreuzband oder bei unbehandelter Instabilität steigt das Risiko für Knorpelschäden und Arthrose deutlich.
- Mit konsequenter Rehabilitation sind die Ergebnisse sehr gut – die meisten Patienten erreichen wieder ihr früheres Aktivitätsniveau.